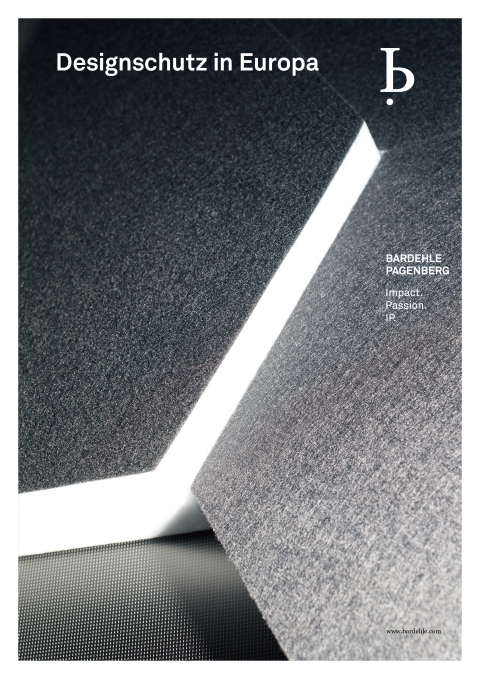Designschutz in Europa
Inhaltsverzeichnis
- 1. Voraussetzungen für Designschutz in Europa
- 2. Überschneidungen zwischen Designrecht und anderen geistigen Eigentumsrechten
- 3. Designrecht in Deutschland und internationales Designrecht
- 4. Designschutz durch Eintragung oder Benutzung
- 5. Verfahren für die Erlangung eingetragener Designrechte
- 6. Nichtigkeitsverfahren gegen eingetragene Unionsgeschmacksmuster bzw. deutsche Designs
- 7. Durchsetzung von Designrechten in Europa (Hauptverfahren)
- 8. Durchsetzung von Designrechten in Europa (Vorverfahren)
1. Voraussetzungen für Designschutz in Europa
Designrecht besteht in Europa aus der Designgesetzgebung der Europäischen Union, die eingetragene und nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster vorsieht, die durch die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in der durch die Verordnung (EU) 2024/2822 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 geänderten Fassung (nunmehr: Verordnung über das Unionsgeschmacksmuster) sowie nationale Designgesetze in den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union geregelt werden, wie sie in wesentlichem Maße zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/2823 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2023 über den rechtlichen Schutz von Designs (Neufassung) harmonisiert werden. Eingetragene Unionsgeschmacksmuster werden vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Sitz in Alicante (Spanien) verwaltet, das auch das Markenrecht der Europäischen Union verwaltet. In dieser Präsentation werden wir europäisches und deutsches Designrecht behandeln.
Die wesentlichen Voraussetzungen für Designschutz in Europa sind „Neuheit“ und „Eigenart“ gemäß Artikel 5 und Artikel 6 GGV sowie den parallelen Bestimmungen in der Richtlinie über den rechtlichen Schutz von Designs. Um Neuheit zu begründen, muss sich das Design in mehr als nur „unwesentlichen Einzelheiten“ von anderen, bestehenden Designs unterscheiden. Ob es Eigenart aufweist oder nicht, hängt davon ab, ob das Design im Vergleich zu älteren Designs beim „informierten Benutzer“ denselben Gesamteindruck erweckt. Dieser fiktive Benutzer ist eine Person, die Kenntnisse über Designs in dem jeweiligen Tätigkeitsbereich hat. Im Gegensatz zu Markenfällen, bei denen der/die Durchschnittsverbraucher/-in die geltend gemachte Marke mit einer anderen vergleichen wird, die er/sie im Kopf hat („unvollkommenes Bild“), werden beim designrechtlichen Vergleich das zu prüfende Design und die anderen Designs direkt nebeneinander betrachtet. Dabei ist dem informierten Benutzer „eine besondere Wachsamkeit eigen, und er verfügt über eine gewisse Kenntnis vom vorherigen Stand der Technik, d. h. vom Formenschatz, der sich auf das fragliche Erzeugnis bezieht“.
2. Überschneidungen zwischen Designrecht und anderen geistigen Eigentumsrechten
Ein Produktdesign oder ein Element eines Produktdesigns kann zugleich sowohl ein Designrecht darstellen als auch unter anderen geistigen Eigentumsrechten schutzfähig sein, insbesondere unter dem Urheber- und Markenrecht. Eine Bildmarke kann auch als Design eingetragen werden (sofern sie Neuheit und Eigenart aufweist), und das dreidimensionale Erscheinungsbild eines Erzeugnisses, das als Design geschützt werden kann, kann auch als Marke eingetragen werden (sofern es unterscheidungskräftig ist). Ebenso können Logos prinzipiell als Designs und Marken geschützt werden.
Designs können auch urheberrechtlich geschützt sein. Ob dies der Fall ist, hängt davon ab, ob sie als urheberrechtlich geschütztes Werk anzusehen sind.
Auch wenn es im Gegensatz zum Design- und Markenrecht, kein EU-weites Urheberrecht gibt, ist innerhalb der Europäischen Union ein unionsrechtlich harmonisierter einheitlicher Werkbegriff anzulegen. In der Regel muss ein Design, um als urheberrechtlich geschütztes „Werk“ zu gelten, zwei kumulative Voraussetzungen erfüllen: Das Designobjekt muss ein Original in dem Sinne sein, dass es eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers darstellt. Die Einstufung als Werk ist dabei Elementen vorbehalten, die eine solche Schöpfung zum Ausdruck bringen. Die Abgrenzung zwischen Design und Urheberrecht ist nicht immer einfach und beschäftigt vielfach deutsche Gerichte wie auch Gerichte der Europäischen Union.
Wenn man Patentschutz für ein bestimmtes Produkt erwerben möchte, sollte man außerdem stets prüfen, ob dieses Produkt Merkmale aufweist, die designrechtlich geschützt werden können. Dies wird regelmäßig der Fall sein (es sei denn, die Merkmale wurden objektiv betrachtet allein aufgrund ihrer Funktionalität gewählt, was selten der Fall sein wird).
3. Designrecht in Deutschland und internationales Designrecht
Mit dem Geschmacksmustergesetz aus dem Jahre 2004 (seit 2014 Designgesetz) wurde die ursprüngliche Richtlinie über Muster und Modelle implementiert, wie in allen 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.
Auf internationaler Ebene kann Designschutz durch die internationale Eintragung von Designs gemäß dem Haager Abkommen über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle (dessen aktuellste Fassung die der Genfer Akte von 1999 ist) erworben werden. Das Haager Abkommen wird vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verwaltet. Deutschland ist Mitglied des Haager Abkommens. Die Europäische Union ist seit 2008 ebenfalls Mitglied des Haager Abkommens. Schutz für die Europäische Union als Ganzes sowie für all ihre Mitgliedsstaaten, die Teil des Haager Abkommens sind, kann durch die Eintragung von Designs beim Internationalen Büro der WIPO erworben werden. Des Weiteren sind die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten Mitglieder der WTO und somit durch das TRIPS-Abkommen gebunden, das minimale Standards des Designschutzes enthält.
4. Designschutz durch Eintragung oder Benutzung
Rechte an Designs werden durch Eintragung und durch Benutzung erworben. Unionsgeschmacksmuster werden als eingetragene Unionsgeschmacksmuster geschützt, nachdem sie beim EUIPO eingereicht und eingetragen wurden, ohne Prüfung der relevantesten materiellen Bedingungen für den Schutz (Neuheit, Eigenart). Schutz durch Benutzung für nicht eingetragene Unionsgeschmacksmuster wird durch die erste Veröffentlichung oder anderweitige Benutzung eines Designs, das die Schutzvoraussetzungen erfüllt, innerhalb der Europäischen Union erlangt.
Eine erstmalige Offenbarung oder Benutzung außerhalb der Europäischen Union begründet keinerlei Rechte in Europa. Das deutsche Designrecht sieht die Eintragung von Designs vor. Das deutsche Recht erkennt keine nicht eingetragenen Designs an. Selbstverständlich sind nicht eingetragene Unionsgeschmacksmuster auch in Deutschland gültig.
Eine Eintragung verleiht dem Inhaber des Designs das ausschließliche Recht, das Design im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Der Schutz erstreckt sich auf sämtliche spätere Designs, die einen im Wesentlichen identischen Eindruck beim informierten Benutzer erwecken. Schutz ist unabhängig von der Produktkategorie erhältlich, zu der das Design gehört. Eingetragene Designs sind sowohl gegen vorsätzliche Nachahmung als auch gegen die unabhängige Entwicklung eines ähnlichen Designs geschützt. Weitere Vorteile eines eingetragenen Designs im Vergleich zu einem nicht eingetragenen Design sind die längere Schutzdauer (bis zu 25 statt 3 Jahre) sowie eine stärkere Position im Falle von Verletzungsverfahren.
Wie bei Marken gibt es für Designs internationale und nationale Eintragungsverfahren:
- nationale Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt in München
- Eintragung als Unionsgeschmacksmuster beim EUIPO in Alicante
- internationale Eintragung beim Internationalen Büro der WIPO in Genf
Das Haager System über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle findet Anwendung in den Ländern, die Partei des Haager Abkommens sind. Januar 2025 waren 82 Länder Mitglieder des Haager Abkommens. Eine internationale Eintragung hat in jedem der benannten Länder dieselbe Wirkung als sei das Design direkt dort eingetragen worden, es sei denn, der Schutz wird von dem zuständigen Amt des jeweiligen Landes abgelehnt. Um eine internationale Anmeldung einzureichen, ist keine vorherige nationale (Basis-) Anmeldung in einem Mitgliedsstaat des Haager Abkommens erforderlich (im Gegensatz zu internationalen Markenanmeldungen unter dem Madrider System).
Das Unionsgeschmacksmuster verleiht dem Inhaber das ausschließliche Recht, einem Dritten die Benutzung eines rechtsverletzenden Designs an einem beliebigen Ort innerhalb der Europäischen Union zu untersagen. Eine einzige Anmeldung bietet Schutz für fünf Jahre, und der Schutz kann um weitere Zeiträume von fünf Jahren auf maximal 25 Jahre verlängert werden. Nicht eingetragene Unionsgeschmacksmuster sind drei Jahre ab dem Datum geschützt, an dem das Geschmacksmuster der Öffentlichkeit in der Europäischen Union offenbart wurde.
Unionsgeschmacksmusterschutz ist eine bevorzugte Vorgehensweise, um in Europa Schutz zu erlangen, da er leicht zugänglich ist, vergleichsweise günstig, einheitlichen Schutz in ganz Europa bietet und gemeinschaftsweit vor eigens dafür bestimmten Unionsgeschmacksmustergerichten durchgesetzt werden kann.
5. Verfahren für die Erlangung eingetragener Designrechte
Für die Eintragung eines Unionsgeschmacksmusters oder eines deutschen Designs muss ein Anmeldeformular eingereicht werden, das eine Darstellung des Designs enthalten muss, das zur Veröffentlichung geeignet ist. Ferner ist die Angabe eines Produkts nötig, für das das Design bestimmt ist. Die Erzeugnisse werden gemäß einem internationalen Klassifikationssystem klassifiziert, das durch das Locarno-Abkommen begründet wurde. Dieses wird auch von der WIPO angewandt. Es können mehrere Designs in einer Sammelanmeldung zusammengefasst werden (deutsche Designs: bis zu 100; Unionsgeschmacksmuster: bis zu 50), wobei die Voraussetzung, dass die Designs einer Sammelanmeldung von Unionsgeschmacksmustern derselben Locarno-Klasse angehören müssen, 2025 entfallen ist. Die Anmeldung mehrerer Designs in einer einzigen Anmeldung spart Kosten. Seit dem 1. März 2010 sind beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) auch Online-Anmeldungen möglich, ebenso wie beim EUIPO.
Nachdem das Anmeldeformular eingereicht wurde, prüft das EUIPO bzw. das DPMA, ob die Anmeldung Formmängel aufweist, ob das angemeldete Design überhaupt geschützt werden kann und mit der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten vereinbar ist. Sind diese Anforderungen erfüllt, wird das Design eingetragen und im elektronischen Geschmacksmusterblatt veröffentlicht. Die erste fünfjährige Schutzdauer beginnt mit dem Datum dieser Veröffentlichung. Wenn das Design in Deutschland angemeldet wurde und die Veröffentlichung der Eintragung die erstmalige Offenbarung des betreffenden Designs war, ist es durch die Veröffentlichung der Eintragung des deutschen Designs im Geschmacksmusterblatt des DPMA automatisch drei Jahre lang als nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt.
Materielle Schutzanforderungen wie Neuheit und Eigenart werden vom DPMA bzw. vom EUIPO nicht geprüft. Dies geschieht nur im Falle von Rechtsstreitigkeiten. Anträge auf Nichtigerklärung eines eingetragenen Unionsgeschmacksmusters können direkt beim EUIPO oder im Wege einer Widerklage in Verletzungsverfahren eingereicht werden. Angriffe auf eingetragene deutsche Designs werden nicht vom DPMA bearbeitet, sie können jedoch unmittelbar bei einem zuständigen Zivilgericht oder als Widerklage im Falle einer Verletzungsklage geltend gemacht werden.
Für die Eintragung eines internationalen Designs sind Anmeldungen beim Internationalen Büro der WIPO einzureichen. Eine einzige Anmeldung kann bis zu 100 separate Designs enthalten. Anmeldungen können auch online eingereicht werden. Die Anmeldung muss die Mitgliedsstaaten des Haager Abkommens enthalten, in denen das Design geschützt werden soll. Die Anmeldegebühr hängt von der Anzahl der ausgewählten Länder ab. Anmeldeformulare sind in englischer und französischer Sprache erhältlich.
6. Nichtigkeitsverfahren gegen eingetragene Unionsgeschmacksmuster bzw. deutsche Designs
Unionsgeschmacksmuster und deutsche Designs werden vor der Eintragung nicht auf Neuheit und Eigenart geprüft. Die mögliche Nichtigkeit eines geltend gemachten Designrechts ist somit im Fall von Rechtsstreitigkeiten von größter Bedeutung. In der Praxis argumentiert der Beklagte in mehr oder weniger allen Designverletzungsfällen, dass das Klagemuster mangels Neuheit und Eigenart nichtig sei. Auch in Fällen, in denen die Gültigkeit des Klagemusters nicht angefochten wird, hat das Verletzungsgericht den Schutzumfang des geltend gemachten Designrechts zu beurteilen, der der Eigenart des Designs entspricht („Reziprozitätsprinzip“). Der Grad an Eigenart muss deshalb in Verletzungsverfahren bestimmt werden und ist oftmals ausschlaggebend bei der Entscheidung, ob das geltend gemachte und das beschuldigte Design „denselben Gesamteindruck“ hervorrufen.
Eingetragene Unionsgeschmacksmuster können außerdem im Wege einer Nichtigkeitsklage vor dem EUIPO angefochten werden. In den Jahren 2022 bis 2024 sind insgesamt über 1.200 Entscheidungen ergangen. Zudem sind im selben Zeitraum 25 Entscheidungen der Beschwerdekammer des EUIPO ergangen und ca. 30 % der angefochtenen Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung wurden bestätigt. Die Rechtsprechung des Gerichts der Europäischen Union oder sogar des Gerichtshofs der Europäischen Union ist noch immer nicht so differenziert wie beispielsweise im Markenrecht. Die Gerichte haben jedoch bereits einige Grundsatzentscheidungen erlassen, die im noch unerforschten, aber immer dichter bevölkerten Gebiet des europäischen Designrechts Orientierung bieten.
7. Durchsetzung von Designrechten in Europa (Hauptverfahren)
Während deutsche Designrechte sowie internationale Designeintragungen, die Deutschland erfassen, nur in Deutschland Schutz bieten, haben Unionsgeschmacksmuster einen „einheitlichen Charakter“ und „dieselbe Wirkung in der gesamten Gemeinschaft“ (Artikel 1 Abs. 3 UGMV) und decken somit alle Mitgliedsstaaten der EU ab. Dementsprechend gilt nach ständiger Rechtsprechung eine Unterlassungsklage aufgrund der Verletzung eines Unionsgeschmacksmusters in der Regel für das gesamte Gebiet der EU, da eine Verletzung, die an einem beliebigen Ort in der Europäischen Union begangen wurde, prinzipiell eine Wiederholungsgefahr für das gesamte Gebiet der EU begründet.
7.1 Zuständige Gerichte und Gerichtsbarkeit
Die Abhilfemittel, die im Falle einer Designverletzung zur Verfügung stehen, sind in der Praxis hauptsächlich zivilrechtliche Abhilfemittel (einstweilige Verfügung, usw.), obwohl es auch strafrechtliche Abhilfemittel gibt, sowie verwaltungsrechtliche Abhilfemittel, wie beispielsweise Grenzbeschlagnahme.
In Deutschland ist die Organisation der Gerichte Sache der 16 Bundesländer. Der Spezialisierungsgrad der Gerichte ist somit von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. In vielen Verletzungsfällen kann der Kläger wählen, bei welchem Gericht er das Verfahren einleitet. Er kann den Sitz des Beklagten wählen oder ein beliebiges Gericht des Ortes, an dem Verletzungshandlungen begangen wurden oder drohen (forum delicti commissi). Designstreitsachen werden in bis zu drei Instanzen verhandelt: In erster Instanz durch die Landgerichte, in zweiter Instanz durch die Oberlandesgerichte und in dritter Instanz durch den Bundesgerichtshof. Auf Grundlage der funktionellen Zuständigkeit innerhalb des Gerichts kann die Klage in erster Instanz bei einer Kammer für Handelssachen eingereicht werden, die aus einem/einer Berufsrichter/-in und zwei Laienrichtern bzw. Laienrichterinnen zusammengesetzt ist. Praktiker entscheiden sich jedoch oft dafür, eine Klage bei den Zivilkammern einzureichen, die aus drei Berufsrichtern bzw. Berufsrichterinnen bestehen.
Die meisten Bundesländer haben die Zuständigkeit für Designstreitsachen auf nur ein Gericht im jeweiligen Bundesland konzentriert. Kläger neigen dazu, diejenigen Gerichte anzurufen, die bekannt dafür sind, dass sie eine große Anzahl an Designstreitsachen bearbeiten, wie z. B. die Landgerichte in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München.
Gegen die Urteile der Landgerichte kann bei den Oberlandesgerichten Berufung eingelegt werden. Diese zweitinstanzlichen Gerichte prüfen im Wesentlichen, ob das erstinstanzliche Urteil die Tatsachen und Beweismittel richtig gewürdigt hat und das Recht richtig angewandt hat. In der Berufungsinstanz erfolgt jedoch keine vollständige Verhandlung de novo. Neue Tatsachen können nur unter bestimmten Bedingungen vorgebracht werden, z. B. wenn der Kläger oder Beklagte nicht fahrlässig gehandelt hat, als er es versäumt hat, diese Tatsachen in erster Instanz einzuführen. Es ist deshalb sehr wichtig, alle relevanten Tatsachen und Verteidigungsmittel bereits in erster Instanz geltend zu machen. Neue rechtliche Argumente können jederzeit vorgebracht werden, auch in zweiter Instanz.
Eine Revision zum Bundesgerichtshof kann vom Oberlandesgericht zugelassen werden, wenn die Sache von grundlegender Bedeutung ist oder das Recht weiterentwickeln kann. In der Praxis sind diese Voraussetzungen hoch und gelten oftmals als nicht erfüllt. Das hat zur Folge, dass in dritter Instanz nur wenige Fälle verhandelt werden. Falls die Revision vom Oberlandesgericht nicht zugelassen wurde, kann beim Bundesgerichtshof ein spezieller Antrag auf Zulassung der Revision eingereicht werden. Nur ein sehr kleiner Prozentsatz dieser Anträge ist erfolgreich. Wird dem Antrag stattgegeben bzw. die Revision vom Oberlandesgericht zugelassen, fällt der Bundesgerichtshof ein Urteil. In der Revision werden ausschließlich Rechtsfragen behandelt. Die Parteien müssen von einem speziellen Anwalt bzw. einer speziellen Anwältin mit Zulassung vor dem Bundesgerichtshof vertreten.
In sehr seltenen Fällen kann Klage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht werden. Das Bundesverfassungsgericht dient nicht als reguläres Revisionsgericht für untere Gerichte oder den Bundesgerichtshof als eine Art „Super-Revisionsinstanz“ für jegliche Verletzungen von Bundesgesetzen. Seine Zuständigkeit ist begrenzt auf verfassungsrechtliche Fragen einschließlich individueller Grundrechte wie Redefreiheit.
Für Verletzungen von (eingetragenen oder nicht eingetragenen) Unionsgeschmacksmustern sind die Unionsgeschmacksmustergerichte zuständig. Dabei handelt es sich um nationale Gerichte, die von den Mitgliedsstaaten dazu bestimmt wurden, Unionsgeschmacksmusterfälle zu bearbeiten. In Deutschland sind prinzipiell dieselben Gerichte für das Verhandeln von deutschen Designstreitsachen zuständig, die auch als Unionsgeschmacksmustergerichte bestimmt wurden. Unionsgeschmacksmustergerichte sind gemeinschaftsweit zuständig, wenn die Klage in dem Mitgliedsstaat eingereicht wird, in dem der Beklagte seinen Sitz hat oder niedergelassen ist oder, wenn dies nicht zutrifft, in dem der Kläger seinen Sitz hat oder niedergelassen ist. Falls weder der Kläger noch der Beklagte einen Sitz oder eine Niederlassung in der Europäischen Union haben, ist das Unionsgeschmacksmustergericht in Alicante (Sitz des EUIPO) gemeinschaftsweit zuständig. Außerdem können Klagen auch vor den Gerichten eines Mitgliedsstaats eingereicht werden, in dem Verletzungshandlungen begangen wurden oder drohen. In dieser Situation ist die Zuständigkeit des Gerichts auf das Gebiet des Mitgliedsstaats beschränkt, in dem es niedergelassen ist (forum delicti commissi).
7.2 Wesentliche Verfahrensgrundsätze
Ein Verletzungsverfahren wird normalerweise durch Versenden einer Abmahnung mit einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung initiiert, die für den Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe enthält. Wird die Angelegenheit nicht im Wege einer solchen Abmahnung geklärt, wird der/die Inhaber/-in einer Marke, eines Designs oder Urheberrechts normalerweise ein einstweiliges Verfügungsverfahren einleiten (siehe unten).
Eine Klage ist bei einem zuständigen Landgericht einzureichen. Die Parteien in Verletzungsverfahren müssen von einem Rechtsanwalt bzw. einer Rechtsanwältin mit Zulassung bei einer deutschen Rechtsanwaltskammer vertreten werden. Optional arbeitet er/sie mit einem Patentanwalt zusammen. Nicht-EU-Bürger/-innen, die in Verfahren vor deutschen Gerichten als Kläger/-in auftreten, müssen auf Antrag des Beklagten eine Sicherheit für Gebühren und Anwaltskosten leisten.
Der Kläger muss Beweise für sämtliche Tatsachen erbringen, die für die Feststellung der Verletzung notwendig sind. Ein Ausforschungsbeweis steht in deutschen Gerichtsverfahren im Allgemeinen nicht zur Verfügung. Jegliche Tatsachen, die nicht mittels Urkundenbeweis belegt werden können, können durch eine Beweisaufnahme im Rahmen einer mündlichen Zeugenvernehmung bearbeitet werden. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Gerichte einen Designgutachter bzw. eine Designgutachterin benötigen, um die Neuheit oder Eigenart des geltend gemachten Designs zu untersuchen; insbesondere bei Designs in dicht besetzten Designgebieten, bei denen sogar Durchschnittsbetrachter/-innen, die Designfragen aufgeschlossen gegenüberstehen, Schwierigkeiten haben, Unterschiede zum bestehenden Formenschatz festzustellen, kann es sinnvoll sein, ein Gutachten heranzuziehen. Viele Fälle werden jedoch auf Grundlage des schriftlichen Vortrags der Parteien und einer anschließenden mündlichen Verhandlung entschieden, in der die vorsitzende Richterin bzw. der vorsitzende Richter die Ansichten des Gerichts erläutert und den Parteien Gelegenheit gibt, ihre Argumente und Ausführungen vorzutragen. Eine formelle Beweisaufnahme bildet in Designverletzungsverfahren eher die Ausnahme.
7.3 Ansprüche dem Grunde nach in Verfahren
Die rechtlichen Instrumente, die dem Kläger in Verletzungsverfahren zur Verfügung stehen, sind u. a. Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung der Verletzungsprodukte sowie detaillierte Auskunftserteilung und Rechnungslegung über Verletzungshandlungen des Beklagten sowie Ansprüche auf Schadensersatz, der auf Grundlage der Rechnungslegung berechnet werden kann (Rechnungslegung über Umsatz, Gewinn usw.).
Außerdem und infolge der Implementierung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004/48/EG) in das deutsche Recht sieht das deutsche Designrecht Folgendes vor:
- Ansprüche auf Beweissicherung;
- Ansprüche auf Rückruf und endgültige Entfernung der Verletzungsprodukte aus den Vertriebskanälen;
- Ansprüche auf Sicherung des Schadensersatzes (Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsdokumenten) unter gewissen Umständen;
- Ansprüche auf Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen;
- Ansprüche auf Inaugenscheinnahme;
- eine Erweiterung bestehender Ansprüche auf Vernichtung von Verletzungsprodukten und Werkzeugen, die bei der Gestaltung oder Herstellung von Verletzungsprodukten vorwiegend verwendet wurden; und
- eine Erweiterung bestehender Auskunftsansprüche.
Bezüglich des Schadensersatzes kann der Kläger zwischen drei Alternativen für dessen Berechnung wählen: entgangener Gewinn, Verletzergewinn oder angemessene Lizenzgebühr. Es wird kein Strafschadensersatz zuerkannt. Während eine angemessene Lizenzgebühr normalerweise die am wenigsten aufwändige dieser Alternativen für die Berechnung des Schadensersatzes darstellt, wird immer häufiger die Berechnung gemäß Verletzergewinn angewandt, da die Rechtsprechung dem Verletzer nun den Abzug von Kosten und Auslagen von den Verkaufszahlen nur dann erlaubt, wenn (und soweit) sie in Ausnahmefällen direkt den Gegenständen zugeordnet werden können, die das Schutzrecht verletzen.
Es dürfen somit nur die variablen Kosten der Herstellung und Vermarktung des Produkts vom generierten Umsatz des Verletzers abgezogen werden. Außerdem kann bei der Bestimmung des Gewinns, der aufgrund der Verletzung generiert wurde, die verletzende Partei nicht behaupten, dass dieser Gewinn teilweise ihren eigenen besonderen Vertriebsaktivitäten zuzuschreiben sei. Allgemeine Kosten dürfen also nicht mehr verwendet werden, um den Verletzergewinn zu reduzieren. Es bleibt jedoch die Frage, ob der Verletzergewinn durch die Designverletzung oder durch andere Umstände verursacht wird, wie beispielsweise gute Kundenbeziehungen, eine marktbeherrschende Stellung, effektive Werbung oder guten Service. Dieselbe Frage stellt sich, wenn der Inhaber des Designs seinen entgangenen Gewinn beansprucht, was häufig die Zuerkennung des höchsten Schadensersatzes erlaubt. Hier taucht ein weiteres Hindernis auf, wenn es auf dem Markt andere Wettbewerber außer dem Kläger und dem Beklagten gab, sodass ein Dritter in gewissem Maße den Umsatz des Beklagten aus den Verletzungen hätte ersetzen können, wenn es die Verletzungshandlungen des Beklagten nicht gegeben hätte.
Wenn Klagen wegen Verletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern erhoben werden, sieht Artikel 89 GGV die Sanktionen der Unterlassung, der Beschlagnahme der Verletzungsprodukte sowie der Beschlagnahme von Materialien und Werkzeug, das vorwiegend dazu verwendet wurde, die Verletzungsprodukte zu erzeugen, vor. Außerdem wenden die Gerichte alle Sanktionen an, die in den Gesetzen des Landes, in dem die Verletzung stattgefunden hat, vorgesehen sind. Falls ein deutsches Unionsgeschmacksmustergericht mit Verletzungen befasst ist, die in Deutschland begangen wurden, können sämtliche Sanktionen angewandt werden, die im Falle von Verletzungen deutscher Designs anwendbar sind.
7.4. Länge der Verfahren und Fristen
Die Länge der Verfahren bei Designverletzungssachen kann je nach Gericht unterschiedlich sein und je nach Arbeitsauslastung des Gerichts variieren. Ein Hauptsacheverfahren wegen Designverletzung dauert in erster Instanz von der Klageerhebung bis zur Urteilsverkündung gewöhnlich sechs bis neun Monate. Je nach Praxis des Gerichts können in einem typischen Fall eine oder mehrere Verhandlungen stattfinden. Ordnet das Gericht eine Beweisaufnahme an, kann eine weitere Sitzung des Gerichts für die Anhörung von Zeugen oder Gutachtern stattfinden; in diesem Fall dauert das Verfahren normalerweise noch drei weitere Monate. Berufungsverfahren dauern in der Regel im Schnitt etwa neun bis zwölf Monate, wobei normalerweise nur eine Gerichtsverhandlung stattfindet. Wird in der Berufungsinstanz Beweis erhoben, sollten etwa drei Monate hinzugerechnet werden. Falls Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen wird, würde das Verfahren vor diesem Gericht wahrscheinlich anderthalb bis zwei Jahre dauern.
Das Verfahren in erster Instanz beginnt damit, dass der Kläger eine umfassende Klage einreicht, die alle relevanten Tatsachen des Falls enthält. Der Beklagte muss dann innerhalb von sechs bis acht Wochen erwidern. Innerhalb eines oder zweier weiterer Monate findet eine mündliche Verhandlung statt. Eine Entscheidung ergeht normalerweise ca. einen Monat nach der mündlichen Verhandlung. Die Entscheidung wird nicht automatisch vollstreckt, wenn Berufung dagegen eingelegt wird. Die vorläufige Vollstreckbarkeit der Entscheidung kann angeordnet werden.
Berufung ist innerhalb eines Monats ab Erhalt der schriftlichen erstinstanzlichen Entscheidung einzulegen. Eine umfassende Begründung muss innerhalb eines weiteren Monats eingereicht werden. Das Oberlandesgericht kann diese Frist verlängern. Normalerweise hat der Berufungsbeklagte einige Monate Zeit, um auf die Berufungsbegründung zu erwidern. Eine Replik des Berufungsklägers ist dann etwa zwei Monate später zu erwarten. Eine mündliche Verhandlung findet ca. drei Monate später statt. Die Entscheidung ergeht innerhalb eines weiteren Monats. Die Entscheidung wird nicht automatisch vollstreckt, wenn Revision eingelegt wird. Eine vorläufige Vollstreckung der Entscheidung kann zugelassen werden, doch ihre zeitweilige Vollstreckung erfordert normalerweise die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung.
Eine Revision kann innerhalb eines Monats nach Mitteilung der zweitinstanzlichen Entscheidung eingelegt werden. Eine umfassende Begründung muss innerhalb eines weiteren Monats eingereicht werden. Der Bundesgerichtshof kann diese Frist verlängern.
7.5 Kosten
Das Kostenrisiko bei Designverfahren umfasst gewöhnlich die Kosten für die Rechtsanwälte und (optional) Patentanwälte beider Parteien zzgl. Gerichtskosten und Auslagen für Zeugen, Reisen usw. Es ist schwierig, eine generelle Schätzung der Verfahrenskosten in der ersten oder zweiten Instanz abzugeben. Um eine Vorstellung über den Umfang der Verfahrenskosten zu bekommen, sollte man sich nur auf die gerichtlichen Anwaltskosten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und die Gerichtskosten konzentrieren. Diese Kosten werden aufgrund des Streitwerts berechnet, der die Interessen des Klägers in der streitigen Angelegenheit widerspiegelt. Der Streitwert wird nach Ermessen des Gerichts festgelegt, basiert jedoch im Wesentlichen auf den Umsatzzahlen der Parteien. Ein typischer Fall kann in der Größenordnung von EUR 250.000 liegen. Die Summe der Kosten für die Vertreter beider Parteien zzgl. Gerichtskosten repräsentiert das gesetzliche Kostenrisiko, da die unterlegene Partei auch die Kosten der obsiegenden Partei tragen muss. Das gesetzliche Kostenrisiko beträgt ca. EUR 25.000 in erster Instanz und ca. EUR 30.000 in zweiter Instanz.
Wie die meisten anderen Kanzleien rechnet BARDEHLE PAGENBERG in Design- und anderen Schutzrechtsangelegenheiten im Allgemeinen nach Stunden ab, was je nach tatsächlichem Arbeitsaufwand dazu führen kann, dass die Anwaltskosten unter Umständen höher sind als die Anwaltskosten gemäß der gesetzlichen Kostenregelung. Da die unterlegene Partei lediglich die gesetzlichen Kosten erstatten muss, kann die obsiegende Partei dennoch Kosten zu tragen haben, die nicht erstattungsfähig sind.
8. Durchsetzung von Designrechten in Europa (Vorverfahren)
Die Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte einschließlich grenzüberschreitender Rechtsstreitigkeiten hat in Deutschland eine lange Tradition, insbesondere im Wege einstweiliger Verfügungsverfahren. Vor allem die vorläufige Durchsetzung eingetragener Rechte ist bei Rechteinhabern sehr beliebt. Die nachfolgenden Informationen gelten gleichermaßen für die Durchsetzung von deutschen Designrechten und Unionsgeschmacksmusterrechten.
8.1 Allgemeine Anmerkungen
Deutsche Gerichte sind weiterhin grundsätzlich dazu bereit, eine einstweilige Verfügung ex parte zu erlassen, wenn die Antragstellerin bzw. der Antragsteller Beweise bezüglich der Inhaberschaft und Gültigkeit des Designrechts, der hinreichenden Wahrscheinlichkeit einer Verletzung und der Dringlichkeit der Angelegenheit vorlegt und eine vorherige Anhörung des mutmaßlichen Verletzers den Zweck der einstweiligen Verfügung vereiteln würde. Der/Die Antragsteller/-in kann Erklärungen („eidesstattliche Versicherungen“) als Beweismittel in dem speziellen Verfahren einreichen. Außerdem tendieren deutsche Gerichte dazu, einstweilige Verfügungen aufgrund nicht eingetragener Rechte zu erlassen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dies gilt vor allem für das nicht eingetragene Unionsgeschmacksmuster.
Der/Die Antragsteller/-in kann Ansprüche auf Unterlassung sowie auf Offenlegung von Informationen über die Verletzungshandlung und einen vorläufigen dinglichen Arrest geltend machen. Infolge der Implementierung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004/48/EG) in das deutsche Recht erlaubt ein einstweiliges Verfügungsverfahren im Allgemeinen die Geltendmachung von Ansprüchen auf Beweissicherung, Inaugenscheinnahme oder Sicherung des Schadensersatzes (Vorlage eines Bank-, Finanz- oder Handelsdokuments).
Diese vorläufige Durchsetzung macht Antragsteller/-innen jedoch potenziell haftbar für jegliche Schäden, die dem Beklagten als Folge der vorläufigen Durchsetzung entstehen, wenn der Fall später gegen den/die Antragsteller/-in entschieden wird. Aus diesem Grund wird der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller gelegentlich die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung auferlegt (Bar- oder Bankgarantie), um dieses Risiko abzusichern, bevor die vorläufige Durchsetzung stattfinden kann. Die Summe dieser Sicherheit wird vom Gericht festgelegt, je nach Streitwert und potenziellen Schäden, die durch eine vorläufige Durchsetzung entstehen können.
8.2 Bestimmte Verfahrensgrundsätze und Zeitablauf
In Deutschland werden viele streitige Angelegenheiten per vorläufigem Rechtsschutz entschieden. Gegen die Entscheidungen der Landgerichte kann bei den Oberlandesgerichten Berufung eingelegt werden. In solchen Fällen gibt es keine Revision zum Bundesgerichtshof.
Ein Antrag auf einstweilige Verfügung vor einem Verletzungsgericht erfordert die „Dringlichkeit“ der Angelegenheit. Die Antragstellerin bzw. Der Antragsteller muss deshalb vorläufigen Rechtsschutz beantragen kurz nachdem sie/er über die mutmaßlich verletzende Handlung Kenntnis erlangt hat, höchstens ein oder zwei Monate ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Kenntniserlangung über alle relevanten Umstände.
Ein vorläufiger Rechtsschutz kann vom Gericht ex parte erteilt werden ohne vorherige Verhandlung, zu der auch der mutmaßliche Verletzer geladen werden würde. Ex parte Verfügungen sind trotz der wiederholten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur „prozessualen Waffengleichheit“ immer noch möglich, wenngleich höhere Anforderungen für Antragsteller/-innen gelten. Anspruchsteller/-innen sollten darauf achten, dass das Vorbringen im Verfügungsantrag auch vollständig im vorangegangenen Abmahnschreiben enthalten ist. Sobald die Anordnung des Gerichts ex parte erlassen wurde, muss der/die Antragsteller/-in die Verfügung innerhalb eines weiteren Monats zustellen, um die Rechte, die aus der Verfügung erwachsen, nicht zu verlieren. Da die einstweilige Verfügung nicht dauerhaft ist, muss der/die Antragsteller/-in außerdem eine Hauptsacheklage einreichen, falls der in Anspruch Genommene die einstweilige Verfügung nicht als endgültig akzeptiert.
Der potenzielle Verletzer, der sich des bevorstehenden Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz möglicherweise bewusst ist, z. B., weil er eine Abmahnung erhalten hat, kann die Möglichkeit der Einreichung einer sog. Schutzschrift bei den deutschen Gerichten in Erwägung ziehen.
Sobald eine einstweilige Verfügung durch das Gericht erlassen wurde, muss sich der mutmaßliche Verletzer an die Verfügung halten; er hat jedoch die Möglichkeit, einen Widerspruch bei dem Gericht einzulegen, das die einstweilige Verfügung erlassen hat, um eine Überprüfung und möglicherweise einen Widerruf der einstweiligen Verfügung zu erwirken. Gegen jede Entscheidung, die überprüft wird, sowie gegen jedes andere vorläufige Urteil, das nach einer mündlichen Verhandlung erlassen wird, kann Berufung beim Oberlandesgericht eingelegt werden.
8.3 Vorläufige Verfügungen und Hauptsacheklagen
Das Konzept der Durchsetzung von Schutzrechten in Deutschland im Wege einstweiliger Verfügungsverfahren ist aus naheliegenden Gründen für Rechteinhaber/-innen sehr attraktiv, wie die zahlreichen Entscheidungen zeigen, die von deutschen erstinstanzlichen Gerichten und den Berufungsgerichten erlassen wurden. Inwiefern lässt sich dann eine einstweilige Verfügung mit einer Hauptsacheklage vergleichen? Der grundlegende begriffliche Unterschied zwischen den beiden Verfahren besteht darin, dass das Hauptsacheverfahren die Angelegenheit endgültig abschließt (einschließlich der Auskunft über Gewinn und Schäden), wohingegen die einstweilige Verfügung auf ein vorläufiges und ausgewähltes Ergebnis gerichtet ist mit der Folge, dass Verletzungen umgehend unterbunden werden. Allgemein gesprochen sind für eine einstweilige Verfügung keine umfangreichen Beweise (wie die Anhörung von Zeuginnen und Zeugen) notwendig, wohingegen komplexe Fälle im Wege einer Hauptsacheklage vor Gericht gebracht werden sollten.