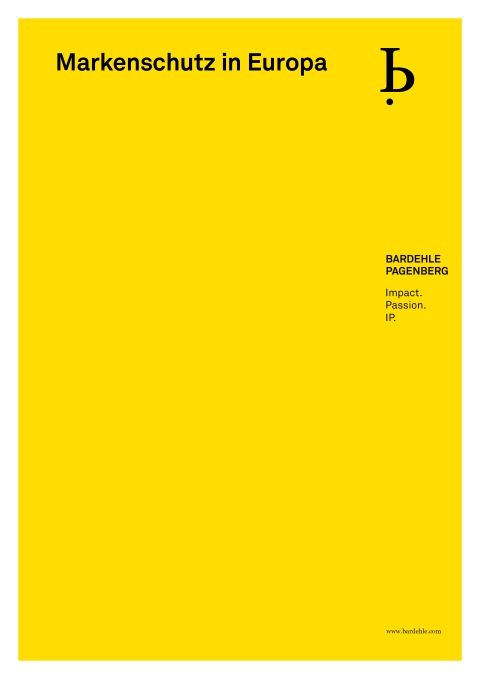Markenschutz in Europa
Inhaltsverzeichnis
- 1. Voraussetzungen für Markenschutz in Europa
- 2. Überschneidung zwischen Markenrecht und anderen geistigen Eigentumsrechten
- 3. Internationales Markenrecht
- 4. Verfahren für die Erlangung von Markenrechten
- 5. Durch die Eintragung gewährte Ausschließlichkeitsrechte
- 6. Markenschutz durch Eintragung oder Benutzung
- 7. Löschungsverfahren gegen eingetragene Unionsmarken oder deutsche Marken wegen Nichtigkeit oder Verfall
- 8. Durchsetzung von Markenrechten in Europa (Hauptverfahren)
- 9. Durchsetzung von Markenrechten in Europa (einstweiliges Verfügungsverfahren)
1. Voraussetzungen für Markenschutz in Europa
Das Markenrecht in Europa umfasst sowohl die Gesetzgebung der Europäischen Union (EU) als auch einzelne Gesetze zum Schutz von Marken der 27 Mitgliedsstaaten der Union.
Die Unionsmarkenverordnung vom Juni 2017 (Verordnung (EU) 2017/1001) ermöglicht die Eintragung von Unionsmarken und bietet somit Schutz in der gesamten EU. Unionsmarken werden vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Sitz in Alicante in Spanien verwaltet. Neben der Unionsmarkenverordnung bestehen in den Mitgliedsstaaten jeweils Markengesetze, die 1988 durch die erste Verordnung im Hinblick auf materielles Recht im Wesentlichen harmonisiert wurden, um die Markengesetze der Mitgliedsstaaten aneinander anzugleichen (Markenverordnung: 2008 kodifiziert als Richtlinie: 2008/95/EG und 2015 neugefasst als Richtlinie (EU) 2015/2436).
Nachdem die drei Benelux-Staaten 1970 ein einheitliches Markensystem ins Leben gerufen haben, gibt es in der EU 25 verschiedene nationale Markensysteme. Das deutsche Markengesetz von 1994 setzt die Verordnung um, ist jedoch zusätzlich noch ein umfassendes Gesetz zum Schutz von allen Kennzeichen. Markenrechtsmodernisierungsgesetze (MaMoG, zuletzt von 2019) setzen Änderungen in deutsches Recht um.
Die Voraussetzungen für Markenschutz durch Eintragung in Europa sind in allen Mitgliedsstaaten und im Markensystem der EU im Wesentlichen dieselben.
Markenschutz steht für alle Arten von Zeichen zur Verfügung, die es ermöglichen, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Solche Zeichen sind beispielsweise herkömmliche Marken wie Wörter, Namen oder Bildzeichen, können aber auch Formen, Farben und Farbzusammenstellungen und sogar nicht sichtbare Zeichen wie beispielsweise Hörzeichen sein. Bisher mussten Marken grafisch darstellbar sein. Die Rechtsprechung hat diese Voraussetzung streng ausgelegt und erforderte die Klarheit, Genauigkeit, Eigenständigkeit, Zugänglichkeit, Verständlichkeit, Beständigkeit und Objektivität der Darstellung. Am 14. Januar 2019 entfiel das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit von Marken. Diese Gesetzgebung setzt voraus, dass die zuständigen Behörden und die Öffentlichkeit in der Lage sind, den eindeutigen und konkreten Schutzgegenstand feststellen zu können.
Für Zeichen mit fehlender Kennzeichnungskraft, welche die Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung, beispielsweise ihre Beschaffenheit, Qualität oder ihren geographischen Ursprung, lediglich beschreiben oder allgemein gehalten sind, kann keine Marke eingetragen werden. Bei der Prüfung, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, werden die Wahrnehmung der Zielgruppe des Zeichens innerhalb der Öffentlichkeit und der Waren und Dienstleistungen, für die Schutz begehrt wird, berücksichtigt. Wurde ein Zeichen vom Schutz ausgeschlossen, weil es nicht unterscheidungskräftig, lediglich beschreibend oder allgemein ist, kann es dennoch geschützt werden, wenn die Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt wurde („Verkehrsgeltung“). Bei Unionsmarken muss die Unterscheidungskraft durch Benutzung hinsichtlich der Teile der EU demonstriert werden, in denen das Schutzhindernis bestand. Außerdem sind Zeichen, die irreführend sind, gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, sowie Zeichen, die mit älteren geschützten geographischen Angaben oder Ursprungsbezeichnungen in Konflikt stehen, vom Schutz ausgeschlossen.
Ein Schutz ist nicht möglich für dreidimensionale Formen, die durch die Beschaffenheit der Waren selbst bedingt sind, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder die den Waren, bezüglich derer eine Marke eingetragen werden soll, einen wesentlichen Wert verleihen.
Zusätzlich zu diesen absoluten Schutzhindernissen stellen ältere Rechte, d. h. Rechte, die vor dem Anmeldetag oder Prioritätstag der späteren Marke erworben wurden, die relativen Schutzhindernisse der Ablehnung oder Nichtigkeit dar. Solche älteren Rechte sind ältere eingetragene Marken, ältere durch Benutzung erworbene Marken und Rechte aus anderen geschäftlichen Bezeichnungen wie beispielsweise Handelsnamen und Erscheinungsbild sowie andere ältere Rechte, die möglicherweise mit einer Marke im Widerspruch stehen wie beispielsweise Rechte an Namen oder Bildern, Designs oder Urheberrechte.
Das System der Unionsmarken basiert auf dem Prinzip der einheitlichen Wirkung einer Unionsmarke. Somit führt jedes absolute Schutzhindernis in einem Teil der EU, genauso wie jedes ältere Recht mit einem die gesamte EU oder einen gesamten Mitgliedsstaat umfassenden Schutzumfang, zu einer Ablehnung oder Nichtigkeit. In den Mitgliedsstaaten stellen ältere Unionsmarken ältere Rechte dar; in Bezug auf andere Aspekte muss das Hindernis im betreffenden Mitgliedsstaat selbst bestehen.
Das heißt: Die nationale Eintragung eines Zeichens, das nicht als Unionsmarke bzw. nicht in einem bestimmten Mitgliedsstaat eingetragen werden kann, weil es beschreibend ist, kann in einem anderen Mitgliedsstaat, in dem eine andere Sprache gesprochen wird, dennoch möglich sein.
In dieser IP Broschüre werden europäisches und deutsches Markenrecht behandelt.
2. Überschneidung zwischen Markenrecht und anderen geistigen Eigentumsrechten
Viele Zeichen, beispielsweise Logos, Formen und Bilder kommen zusätzlich zum Markenschutz noch für andere geistige Eigentumsrechte in Frage, insbesondere für Urheber- und Designschutz.
Beispielsweise kann die Form einer Flasche oder einer Vorrichtung, die als Marke eingetragen werden kann, auch als Design (früher war die Bezeichnung "Geschmacksmuster" gebräuchlich) gemäß Verordnung über das EU-Design geschützt werden, wenn sie neu ist und Eigenart aufweist.
Marken können auch Gegenstand des Urheberrechts sein. Ob das der Fall ist, hängt vom geltenden Recht des jeweiligen Mitgliedsstaates der EU ab. Im Gegensatz zum Design- und Markenrecht gibt es kein unionsweites Urheberrecht und die Voraussetzungen für Urheberschutz sind nicht harmonisiert. Allerdings sind Urheberrechte Gegenstand verschiedener Verordnungen mit unionsweiter Geltung. Deswegen ist die Auslegung, ab wann ein "Werk" urheberrechtlichen Schutz genießt, insbesondere auch durch die europäischen Gerichte geprägt, mit Geltung auch in den Mitgliedstaaten. In der Regel muss eine Marke, um als urheberrechtlich geschütztes „Werk“ zu gelten, das Ergebnis einer persönlichen intellektuellen Bemühung sein, die von der Persönlichkeit des Urhebers geprägt ist. Ab wann diesem Erfordernis Genüge getan ist, ist daher stets eine Frage des Einzelfalls und lässt sich nicht pauschal beurteilen.
3. Internationales Markenrecht
Markenschutz kann auch durch internationale Eintragung erlangt werden. Das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken von 1989 ersetzt das frühere Madrider Abkommen von 1891. Das Madrider System wird durch die WIPO (International Bureau of the World Intellectual Property Organization) verwaltet.
Eine internationale Eintragung muss auf einer Anmeldung oder Eintragung derselben Marke in einem der Mitgliedsländer des Madrider Abkommens basieren und muss über die Ursprungsbehörde beantragt werden.
Der Schutz kann in jedem anderen Mitgliedsland des Madrider Abkommens beantragt werden. Alle Mitgliedsstaaten der EU (mit der Ausnahme von Malta) gehören dem Madrider System an. Die EU trat dem Madrider Protokoll 2004 bei. Somit kann durch die Eintragung von Marken beim Internationalen Büro der WIPO Schutz für die EU als Ganzes sowie für all ihre Mitgliedsstaaten, die Teil des Madrider Abkommens sind, erlangt werden. Außerdem sind die EU und ihre Mitgliedsstaaten Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO - World Trade Organization) und müssen sich somit an das TRIPS-Abkommen halten, das auch Mindeststandards bezüglich des Schutzes von Marken enthält. Die Unionsmarkenverordnung und die deutsche Markenverordnung sind mit den TRIPS-Anforderungen konsistent.
4. Verfahren für die Erlangung von Markenrechten
Um die Eintragung einer Unionsmarke zu erlangen, muss entweder direkt beim EUIPO in Alicante in Spanien oder durch eine zuständige Behörde in einem der Mitgliedsstaaten ein Antrag gestellt werden. Der Antrag muss die Marke und ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen unter Verwendung der internationalen Nizza-Klassifikation von Waren und Dienstleistungen beinhalten. Anträge können das Prioritätsdatum einer früheren Anmeldung in einem Mitgliedsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder Welthandelsorganisation beanspruchen. Die Gebühren für die Anmeldung und für zusätzliche Klassen ab der zweiten Klasse sind innerhalb eines Monats ab Antragsdatum fällig.
Antragsteller/-innen ohne Wohn- oder Unternehmenssitz in der EU müssen eine(n) Vertreter/-in mit Sachkunde und der Vertretungsberechtigung in Markensachen in einem der Mitgliedsstaaten benennen.
Anträge werden von Amts wegen auf Einhaltung der Formerfordernisse und auf absolute Eintragungshindernisse geprüft. Das EUIPO führt auch eine Recherche hinsichtlich älterer Unionsmarken durch und informiert Antragsteller/-innen und Inhaber/-innen älterer Rechte. Auch einige nationale Ämter der Mitgliedstaaten führen solche Recherchen in ihren Registern durch, die Antragsteller/-innen dort beantragen können.
Nach der Veröffentlichung der Markenanmeldung können Inhaber/-innen älterer Rechte Widerspruch gegen die Eintragung einlegen. Die Widerspruchsfrist beträgt drei Monate. Inhaber/-innen älterer Rechte, die sich auf ältere eingetragene Marken berufen, müssen die Benutzung ihrer Marken nachweisen, wenn die Benutzung vom Antragsteller bzw. von der Antragstellerin bestritten wird und die ältere Marke seit über fünf Jahren eingetragen ist. Wird kein Widerspruch eingelegt bzw. wird das Widerspruchsverfahren ohne Zurückweisung des Antrags abgeschlossen, wird die Marke eingetragen und die Eintragung veröffentlicht.
Gegen Zurückweisungen durch die Prüfer/-innen des EUIPO und die Widerspruchsabteilungen kann vor den gerichtsähnlichen Beschwerdekammern des EUIPO Beschwerde eingelegt werden. Weitergehende Rechtsmittel können in erster Instanz vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) und in zweiter Instanz bezüglich Rechtsfragen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) eingelegt werden.
Die Anmeldung einer Unionsmarke ist eine der besten Vorgehensweisen, um in Europa Schutz zu erlangen, da der durch sie gewährte Schutz leicht zugänglich, vergleichsweise günstig sowie einheitlich für ganz Europa ist, und in der gesamten EU bei eigens dafür bestimmten Unionsmarkengerichten durchgesetzt werden kann.
In Deutschland sind Anträge beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München einzureichen. Das Eintragungsverfahren ist demjenigen des EUIPO sehr ähnlich.
Das DPMA führt jedoch keine Recherchen zu älteren Marken durch. Außerdem kann in Deutschland erst nach der Eintragung Widerspruch eingelegt werden und ein erfolgreicher Widerspruch führt nicht zur Ablehnung der betreffenden Marke, sondern zu deren Löschung. Gegen Entscheidungen des DPMA kann vor dem Bundespatentgericht (BPatG), das sich ebenfalls in München befindet, Beschwerde eingelegt werden. Dort wird eine Prüfung de novo durchgeführt.
Eine Revision zum Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH) zum Zweck der Prüfung von Rechtsfragen ist möglich, wenn die Revision durch das BPatG gestattet ist oder die unterlegene Partei eine materiell- oder verfahrensrechtliche Rechtsverletzung geltend macht. Sowohl das EUIPO als auch das DPMA bieten umfassende Onlinedienste an, beispielsweise elektronische Anmeldungen und Akteneinsicht.
Eingetragene Unionsmarken und eingetragene deutsche Marken sind zunächst zehn Jahre ab Antragsdatum gültig. Der Markenschutz kann immer wieder um weitere zehn Jahre verlängert werden.
5. Durch die Eintragung gewährte Ausschließlichkeitsrechte
Durch die Eintragung einer Marke erhält der/die Inhaber/-in das ausschließliche Recht, sie im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Die durch Unionsmarken und deutsche Marken verliehenen Rechte sind dieselben.
Jedoch erstreckt sich der gewährte Schutz bei Unionsmarken auf das gesamte Gebiet der EU und bei deutschen Marken auf das gesamte Gebiet Deutschlands.
Der/Die Inhaber/-in ist berechtigt, Dritten die Benutzung von folgenden Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu untersagen:
- Zeichen, die mit der eingetragenen Marke identisch sind in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, hinsichtlich derer die Marke eingetragen ist, identisch sind;
- Zeichen, bei denen seitens der Öffentlichkeit aufgrund der Gleichheit oder Ähnlichkeit mit der eingetragenen Marke bzw. mit den von der Marke und dem Zeichen geschützten Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslung wahrscheinlich ist; die Verwechslungsgefahr schließt auch die gedankliche Verbindung zwischen dem Zeichen und der Marke ein;
- Zeichen, die identisch oder ähnlich mit der eingetragenen Marke sind, in Bezug auf identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen, soweit die eingetragene Marke (hinsichtlich Unionsmarken) in der EU oder (hinsichtlich deutscher Marken) in Deutschland Bekanntheit erlangt hat und soweit die Benutzung dieser Zeichen ohne hinreichenden Grund einen unfairen Nutzen aus der Kennzeichnungskraft oder der Bekanntheit der eingetragenen Marke ziehen oder ihnen schaden würde.
6. Markenschutz durch Eintragung oder Benutzung
Eine Unionsmarke kann nur durch Eintragung erlangt werden. Doch alle Mitgliedsstaaten müssen auch ohne Benutzung Schutz für namhafte Marken gewähren. Außerdem erteilen viele Länder, darunter auch Deutschland, Schutz auf der Grundlage der gewerblichen Benutzung. In Deutschland wird der Schutz gewährt, wenn sich eine Marke im Handel etabliert hat; das erfordert, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Marke kennt („Verkehrsgeltung“).
7. Löschungsverfahren gegen eingetragene Unionsmarken oder deutsche Marken wegen Nichtigkeit oder Verfall
Die Gründe für die Löschung von eingetragenen Marken wegen Nichtigkeit oder Verfall sind bei Unionsmarken und deutschen Marken dieselben.
Verfallsgründe einer Marke sind: Nichtbenutzung, Entwicklung in allgemein übliches Zeichen oder täuschende Angaben. Gründe für die Nichtigkeit einer Marke sind alle absoluten und relativen Schutzhindernisse, welche die Eintragung ausschließen, sowie jegliche ältere Rechte, die mit der eingetragenen Marke im Konflikt stehen. Ein zusätzlicher Nichtigkeitsgrund ist die bösgläubige Anmeldung.
Löschungsverfahren gegen Unionsmarken können durch Antrag an das EUIPO angestrengt werden. Gegen die Entscheidungen der Löschungsabteilungen des EUIPO kann Berufung vor den Beschwerdekammern und danach vor dem EuG und dem EuGH eingelegt werden.
Weitere Möglichkeiten sind Löschungsklagen als Gegenanspruch zu einer Verletzungsklage, die von einem/einer Inhaber/-in einer Unionsmarke erhoben wurde. Für solche Klagen sind ausschließlich die Unionsmarkengerichte zuständig.
Bei deutschen Marken kann die Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit von Marken entweder beim DPMA beantragt oder bei den Zivilgerichten eingeklagt werden. Beide Stellen sind insoweit zuständig und es besteht ein Wahlrecht zugunsten des/der Antragsteller/-in oder des/der Kläger/-in (einzige Ausnahme ist die Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse; ein entsprechender Löschungsantrag muss zwingend beim DPMA gestellt werden, die Zivilgerichte sind hierfür nicht zuständig).
8. Durchsetzung von Markenrechten in Europa (Hauptverfahren)
Unionsmarken (einschließlich Marken gemäß Madrider Protokoll mit Wirkung in der EU) sind „einheitlich“ und haben „einheitliche Wirkung für die gesamte Union“ (Artikel 1 Absatz 2 Unionsmarkenverordnung). Sie gelten somit im gesamten Gebiet der EU. Dementsprechend ist es gängige Rechtsprechung, dass ein Unterlassungsanspruch wegen der Verletzung einer Unionsmarke grundsätzlich im gesamten Gebiet der EU gilt, da eine Verletzung an einem beliebigen Ort in der EU prinzipiell das Risiko einer erneuten Verletzung im gesamten Gebiet der EU begründet. Deutsche Marken und internationale Eintragungen (gemäß dem Madrider Abkommen) mit Wirkung in Deutschland gelten für Deutschland, und Verletzungsklagen können angestrengt werden, um mit Wirkung für Deutschland Unterlassung und anderweitige Abhilfe zu erlangen.
8.1 Zuständige Gerichte und Gerichtsbarkeit
In Deutschland ist die Organisation der Gerichte Sache der 16 Bundesländer. Der Spezialisierungsgrad der Gerichte ist somit von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. In vielen Verletzungsfällen kann der Kläger selbst entscheiden, bei welchem Gericht er das Verfahren einleitet. Er kann den Sitz des Beklagten wählen oder ein beliebiges Gericht des Ortes, an dem Verletzungshandlungen begangen wurden oder drohen (forum delicti commissi).
Markenverletzungssachen werden in bis zu drei Instanzen verhandelt: In erster Instanz durch die Landgerichte, in zweiter Instanz durch die Oberlandesgerichte und in dritter Instanz durch den BGH. Die Zivilkammern in der ersten Instanz setzen sich aus drei Berufsrichtern bzw. -richterinnen zusammen. Streitsachen können auch Kammern für Handelssachen, die mit einem/einer hauptberuflichen Richter/-in und drei ehrenamtlichen Richter/-innen besetzt sind, vorgelegt werden.
Die Bundesländer haben die Zuständigkeit für Markenstreitsachen auf nur ein Gericht in jedem Bundesland konzentriert. Kläger neigen dazu, diejenigen Gerichte anzurufen, die für ihre Sachkunde und dafür bekannt sind, dass sie eine große Anzahl von Markenstreitsachen bearbeiten, wie z. B. die Landgerichte in Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Mannheim und München.
Anwältinnen bzw. Anwälte können unabhängig davon, wo sie ihren Sitz haben, vor jedem dieser Gerichte auftreten.
Gegen die Urteile der Landgerichte kann bei den Oberlandesgerichten Berufung eingelegt werden. Diese zweitinstanzlichen Gerichte prüfen im Wesentlichen, ob das erstinstanzliche Urteil die Tatsachen und Beweismittel richtig gewürdigt und das Recht richtig angewandt hat. In der Berufungsinstanz erfolgt jedoch keine vollständige Verhandlung de novo. Neue Tatsachen dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen vorgelegt werden, z. B. wenn der Kläger oder der Beklagte nicht fahrlässig gehandelt hat, als versäumt wurde, diese Tatsachen in der ersten Instanz ins Verfahren einzubringen.
Es ist deshalb sehr wichtig, alle relevanten Tatsachen und Verteidigungsmittel bereits in erster Instanz geltend zu machen. Neue rechtliche Argumente können jederzeit vorgebracht werden, auch in zweiter Instanz. Eine Revision zum BGH kann vom Berufungsgericht gestattet werden, wenn die Sache von grundlegender Bedeutung ist oder eine Entscheidung durch den BGH zur Weiterentwicklung des Rechts erforderlich ist. In der Praxis gestatten die Berufungsgerichte nur selten eine Revision. Parteien, die mit einer Entscheidung unzufrieden sind, können auch beantragen, dass der BGH eine Revision trotz der Weigerung des Berufungsgerichts zulässt. Solche Nichtzulassungsbeschwerden sind nur selten erfolgreich. Wird die Revision vom Berufungsgericht zugelassen oder ist die Nichtzulassungsbeschwerde erfolgreich, wird die Sache dem BGH zur Entscheidung vorgelegt.
In dieser Revision werden ausschließlich Rechtsfragen behandelt. Die Parteien müssen hier von einem speziellen Anwalt bzw. einer speziellen Anwältin mit Zulassung vor dem BGH vertreten werden. Sehr selten kann eine Sache dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorgelegt werden. Das Bundesverfassungsgericht dient nicht als reguläres Revisionsgericht für Gerichte niederer Instanzen oder dem BGH als eine Art „Super-Revisionsinstanz“ für jegliche Verstöße gegen Bundesgesetze. Seine Zuständigkeit ist begrenzt auf verfassungsrechtliche Fragen einschließlich individueller Grundrechte wie z. B. die Meinungsfreiheit.
Die Verletzung von Unionsmarken unterliegt der Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte. Dabei handelt es sich um nationale Gerichte, die von den Mitgliedsstaaten dazu bestimmt wurden, Unionsmarkensachen zu bearbeiten.
Im Prinzip sind die Gerichte, die für deutsche Markensachen zuständig sind, auch zu Unionsmarkengerichten ernannt worden. Unionsmarkengerichte sind unionsweit zuständig, wenn die Klage in dem Mitgliedsstaat eingereicht wird, in dem der Beklagte seinen Sitz hat oder niedergelassen ist oder, wenn dies nicht zutrifft, in dem der Kläger seinen Sitz hat oder niedergelassen ist. Falls weder der Kläger noch der Beklagte einen Sitz oder eine Niederlassung in der EU haben, ist das Unionsmarkengericht in Alicante (Sitz des EUIPO) unionsweit zuständig. Außerdem können Klagen auch vor den Gerichten eines Mitgliedsstaats, in dem Verletzungshandlungen begangen wurden oder drohen, eingereicht werden. Dann ist die Zuständigkeit des Gerichts auf das Gebiet des Mitgliedsstaats beschränkt, in dem es niedergelassen ist (forum delicti commissi).
In zweiter Instanz sind auch hier wiederum die Berufungsgerichte des Zuständigkeitsbereichs, in dem sich das Landgericht befindet, zuständig. Revisionen durch den BGH sind, wie bereits dargelegt, bei Rechtsfragen möglich.
Bei Verletzungsstreitsachen in Bezug auf deutsche Marken und/oder Unionsmarken haben die Gerichte niedrigerer Instanzen die Möglichkeit und hat der BGH die Pflicht, Fragen zur Auslegung des Unionsrechts dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen. Seit Erlass der Markenverordnung und der Unionsmarkenverordnung wurden vom EuGH über 100 Entscheidungen gefällt. Die deutschen Gerichte haben sich oft dieses Vorabentscheidungsverfahrens bedient.
8.2 Wesentliche Verfahrensgrundsätze
Ein Verletzungsverfahren wird normalerweise durch das Versenden einer Abmahnung mit einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung initiiert, die für den Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe enthält. Wird die Angelegenheit nicht im Wege einer solchen Abmahnung geklärt, leitet der/die Inhaber/-in einer Marke (oder eines sonstigen intellektuellen Eigentumsrechts) normalerweise ein einstweiliges Verfügungsverfahren ein (siehe unten).
Eine Klage ist bei einem zuständigen Landgericht einzureichen. Die Parteien in Verletzungsverfahren müssen von einer Rechtsanwältin bzw. einem Rechtsanwalt vertreten werden, die/der bei einer deutschen Rechtsanwaltskammer zugelassen ist und optional mit einer Patentanwältin bzw. einem Patentanwalt zusammenarbeitet. Nicht-EU-Bürger/-innen, die in Verfahren vor deutschen Gerichten als Kläger auftreten, müssen auf Antrag der Beklagten vorab eine Sicherheit für die Gebühren und Anwaltskosten leisten. Der Kläger muss Beweise für sämtliche Tatsachen erbringen, die für die Feststellung der Verletzung notwendig sind.
Ein Ausforschungsbeweis steht in deutschen Gerichtsverfahren im Allgemeinen nicht zur Verfügung. Jegliche Tatsachen, die nicht mittels Urkundenbeweis belegbar sind, können durch eine Beweisaufnahme im Rahmen einer mündlichen Zeugenvernehmung bearbeitet werden. Viele Fälle werden jedoch auf Grundlage des schriftlichen Vortrags der Parteien und einer anschließenden mündlichen Verhandlung, in welcher der/die vorsitzende Richter/-in die Ansichten des Gerichts erläutert und den Parteien Gelegenheit gibt, ihre Argumente und Ausführungen vorzutragen, entschieden. Die formale Beweisaufnahme ist in Markenverletzungsverfahren vorwiegend auf den Nachweis der durch Benutzung erworbenen Kennzeichnungs- oder Unterscheidungskraft oder Bekanntheit beschränkt; die Verwechslungsgefahr beurteilt das Gericht im Allgemeinen als Rechtsfrage.
8.3 Ansprüche dem Grunde nach in Verfahren (Abhilfemittel)
Die rechtlichen Instrumente, die dem Kläger in Verletzungsverfahren zur Verfügung stehen, sind u. a. Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung der Verletzungsprodukte sowie detaillierte Auskunftserteilung und Rechnungslegung über Verletzungshandlungen der Beklagten sowie Ansprüche auf Schadensersatz, der auf Grundlage der Rechnungslegung berechnet werden kann (Rechnungslegung bezüglich Umsatz, Gewinn usw.). Außerdem, und infolge der Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004/48/EG), in deutsches Recht sieht das deutsche Markenrecht Folgendes vor:
- Ansprüche auf Beweissicherung;
- Ansprüche auf Rückruf und endgültige Entfernung der Verletzungsprodukte aus den Vertriebskanälen;
- Ansprüche auf Sicherung des Schadensersatzes (Vorlage von Bank, Finanz- oder Handelsunterlagen) unter gewissen Umständen;
- Ansprüche auf Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen;
- Ansprüche auf Inaugenscheinnahme;
- eine Erweiterung bestehender Ansprüche auf Vernichtung von gefälschten Produkten und Werkzeugen, die bei der Gestaltung oder Herstellung von Verletzungsprodukten vorwiegend verwendet wurden; und
- eine Erweiterung bestehender Auskunftsansprüche.
Bezüglich des Schadensersatzes kann der Kläger zwischen drei Alternativen zur Berechnung des Schadensersatzes wählen: entgangener Gewinn, Verletzergewinn oder angemessene Lizenzgebühr. Es wird kein Strafschadensersatz zuerkannt. Während eine angemessene Lizenzgebühr normalerweise die am wenigsten aufwändige dieser Alternativen zur Berechnung des Schadensersatzes darstellt, wird immer häufiger die Berechnung gemäß Verletzergewinn angewandt, da die Rechtsprechung dem Verletzer nun den Abzug von Kosten und Auslagen von den Verkaufszahlen nur dann erlaubt, wenn (und nur soweit) sie in Ausnahmefällen direkt den Gegenständen zugeordnet werden können, die das Schutzrecht verletzen. Es dürfen somit nur die variablen Kosten der Herstellung und Vermarktung des Produkts vom generierten Umsatz des Verletzers abgezogen werden.
Außerdem kann bei der Bestimmung des Gewinns, der aufgrund der Verletzung erwirtschaftet wurde, die verletzende Partei nicht behaupten, dass dieser Gewinn teilweise ihren eigenen besonderen Vertriebsaktivitäten zuzuschreiben sei. Allgemeine Kosten dürfen also nicht mehr verwendet werden, um den Verletzergewinn zu reduzieren. Es bleibt jedoch die Frage, ob der Verletzergewinn durch die Markenverletzung oder durch andere Umstände verursacht wird, wie beispielsweise gute Kundenbeziehungen, eine marktbeherrschende Stellung, effektive Werbung oder guten Service. Dieselbe Frage stellt sich, wenn der/die Inhaber/-in der Marke den entgangenen Gewinn beansprucht, was häufig die Zuerkennung des höchsten Schadensersatzes ermöglichen würde. Hier taucht ein weiteres Hindernis auf, wenn es auf dem Markt andere Wettbewerber außer dem Kläger und dem Beklagten gab, sodass Dritte in gewissem Maße den Umsatz des Beklagten aus den Verletzungen hätten ersetzen können, wenn es die Verletzungshandlungen des Beklagten nicht gegeben hätte.
Bei Erhebung von Verletzungsklagen in Bezug auf Unionsmarken sieht Artikel 130 der Unionsmarkenverordnung die Sanktion der Unterlassung vor. Außerdem wenden die Gerichte alle Sanktionen an, die in den Gesetzen des Landes, in dem die Verletzung stattgefunden hat, vorgesehen sind. Falls ein deutsches Unionsmarkengericht mit Verletzungen befasst ist, die in Deutschland begangen wurden, können sämtliche Sanktionen angewandt werden, die im Falle von Verletzungen deutscher Marken anwendbar sind.
8.4 Dauer der Verfahren und Fristen
Die Dauer des Verfahrens bei Markenverletzungssachen ist je nach Gericht unterschiedlich und variiert je nach Arbeitsauslastung des Gerichts. Ein Hauptsacheverfahren wegen einer Markenverletzung dauert in erster Instanz von der Klageerhebung bis zur Urteilsverkündung gewöhnlich sechs bis neun Monate. Je nach Praxis des Gerichts können in einem typischen Fall eine oder mehrere Verhandlungen stattfinden. Ordnet das Gericht eine Beweisaufnahme an, kann eine weitere Sitzung des Gerichts für die Anhörung von Zeugen oder Gutachtern stattfinden; in diesem Fall nimmt das Verfahren normalerweise noch drei weitere Monate in Anspruch. Berufungsverfahren dauern in der Regel im Schnitt etwa neun bis zwölf Monate, wobei normalerweise nur eine Gerichtsverhandlung stattfindet. Wird in der Berufungsinstanz Beweis erhoben, sollten etwa drei Monate hinzugerechnet werden.
Falls eine Revision zum BGH zugelassen wird, dauert das Verfahren vor diesem Gericht wahrscheinlich anderthalb bis zwei Jahre. Das Verfahren in erster Instanz beginnt damit, dass der Kläger eine umfassende Klage einreicht, welche alle relevanten Tatsachen des Falls enthält. Die Beklagte muss dann innerhalb von sechs bis acht Wochen erwidern. Innerhalb eines oder zweier weiterer Monate findet eine mündliche Verhandlung statt. Eine Entscheidung ergeht normalerweise ca. einen Monat nach der mündlichen Verhandlung. Die Entscheidung wird nicht automatisch vollstreckt, wenn Berufung dagegen eingelegt wird. Eine vorläufige Vollstreckung kann durch eine Sonderverfügung genehmigt werden.
Berufung ist innerhalb eines Monats ab Erhalt der schriftlichen erstinstanzlichen Entscheidung einzulegen. Eine umfassende Begründung muss innerhalb eines weiteren Monats eingereicht werden. Das Berufungsgericht kann diese Frist verlängern. Normalerweise hat der Berufungsbeklagte einige Monate Zeit, um auf die Berufungsbegründung zu erwidern. Eine Replik des Berufungsklägers ist dann etwa zwei Monate später zu erwarten. Eine mündliche Verhandlung findet ungefähr drei Monate später statt. Die Entscheidung ergeht innerhalb eines weiteren Monats. Die Entscheidung wird nicht automatisch vollstreckt, wenn Revision eingelegt wird.
Eine vorläufige Vollstreckung der Entscheidung kann zugelassen werden, doch ihre zeitweilige Vollstreckung erfordert normalerweise die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung.
Eine Revision kann innerhalb eines Monats nach Mitteilung der zweitinstanzlichen Entscheidung eingelegt werden. Eine umfassende Begründung muss innerhalb eines weiteren Monats eingereicht werden. Der BGH kann diese Frist verlängern.
8.5 Kosten
Das Kostenrisiko bei Markenverfahren umfasst für gewöhnlich die Kosten für die Rechtsanwältinnen bzw. Rechtsanwälte und (optional) Patentanwältinnen bzw. Patentanwälte beider Parteien zzgl. Gerichtskosten und Auslagen für Zeuginnen und Zeugen sowie Reisekosten etc. Es ist schwierig, eine generelle Schätzung der Verfahrenskosten in der ersten oder zweiten Instanz abzugeben. Um eine Vorstellung von der Größenordnung der Verfahrenskosten zu bekommen, sollte man sich nur auf die gesetzlichen Anwaltskosten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und die Gerichtskosten konzentrieren. Diese Kosten werden aufgrund des Streitwerts berechnet, der die Interessen des Klägers in der streitigen Angelegenheit widerspiegelt. Der Streitwert wird nach Ermessen des Gerichts festgelegt, basiert jedoch im Wesentlichen auf den Umsatzzahlen der Parteien. In einem typischen Fall kann der Streitwert in der Größenordnung von EUR 250.000 liegen.
Die Summe der Kosten für die Vertreter/-innen beider Parteien zzgl. Gerichtskosten stellt das gesetzliche Kostenrisiko dar, denn die unterlegene Partei muss auch die Kosten der obsiegenden Partei tragen. Das gesetzliche Kostenrisiko beträgt, legt man wie soeben dargestellt einen Streitwert von EUR 250.000 zugrunde, ca. EUR 25.000 in erster Instanz und ca. EUR 30.000 in zweiter Instanz. Wie die meisten anderen Kanzleien rechnet BARDEHLE PAGENBERG in Marken- und anderen Schutzrechtsangelegenheiten im Allgemeinen nach Stunden ab, was je nach tatsächlichem Arbeitsaufwand dazu führen kann, dass diese Kosten unter Umständen höher sind als die Anwaltskosten gemäß der gesetzlichen Kostenregelung. Da die unterlegene Partei lediglich die gesetzlichen Kosten erstatten muss, hat die obsiegende Partei möglicherweise dennoch Kosten zu tragen, die nicht erstattungsfähig sind.
9. Durchsetzung von Markenrechten in Europa (einstweiliges Verfügungsverfahren)
Die Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte einschließlich grenzüberschreitender Rechtsstreitigkeiten hat in Deutschland eine lange Tradition, vor allem im Wege einstweiliger Verfügungsverfahren.
Insbesondere die vorläufige Durchsetzung eingetragener Rechte ist bei Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern sehr beliebt. Die nachfolgenden Informationen gelten gleichermaßen für die Durchsetzung von deutschen Markenrechten und von Unionsmarkenrechten.
9.1 Allgemeine Anmerkungen
Deutsche Gerichte sind dazu befugt, eine einstweilige Verfügung ex parte zuzulassen, wenn der/die Antragsteller/-in Beweise bezüglich der Inhaberschaft und Gültigkeit seines Markenrechts, der hinreichenden Wahrscheinlichkeit der Verletzung und der Dringlichkeit der Angelegenheit vorlegt. Der/Die Antragsteller/-in kann Erklärungen („eidesstattliche Versicherungen“) als Beweismittel in dem speziellen Verfahren einreichen. Außerdem tendieren deutsche Gerichte dazu, einstweilige Verfügungen aufgrund nicht eingetragener Rechte zu erlassen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Der/Die Antragsteller/-in kann Ansprüche auf Unterlassungsverfügung sowie auf Offenlegung von Informationen über die Verletzungshandlung und einen vorläufigen dinglichen Arrest geltend machen. Infolge der Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (2004/48/ EG) in deutsches Recht erlaubt ein einstweiliges Verfügungsverfahren im Allgemeinen die Geltendmachung von Ansprüchen auf Beweissicherung, Inaugenscheinnahme oder Sicherung des Schadensersatzes (Vorlage eines Bank-, Finanz- oder Handelsdokuments).
Diese vorläufige Durchsetzung macht den/die Antragsteller/-in jedoch potenziell haftbar für jegliche Schäden, die dem Beklagten als Folge der vorläufigen Durchsetzung entstehen, wenn der Fall später gegen den/die Antragsteller/-in entschieden wird. Aus diesem Grund wird dem/der Antragsteller/-in gelegentlich die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung auferlegt (Bar- oder Bankgarantie), um dieses Risiko abzusichern, bevor die vorläufige Durchsetzung stattfinden kann. Die Summe dieser Sicherheit wird vom Gericht festgelegt, je nach Streitwert und potenziellen Schäden, die durch eine vorläufige Durchsetzung entstehen können.
Auch vorläufiger Rechtsschutz ist im Fall der Verletzung von Unionsmarken möglich. Zusätzlich zu den Unionsmarkengerichten können alle anderen Gerichte, die für Markensachen zuständig sind, angerufen werden. Doch nur Unionsmarkengerichte mit Zuständigkeit für die gesamte EU können Verfügungen erlassen oder Rechtsschutz gewähren, die bzw. der sich über die Grenzen des Mitgliedsstaats, in dem sich das Gericht befindet, erstrecken bzw. erstreckt.
9.2 Konkrete Verfahrensgrundsätze und zeitlicher Ablauf
In Deutschland werden viele streitige Angelegenheiten durch vorläufige Verfahren entschieden. Gegen die Entscheidungen der Landgerichte kann bei den Oberlandesgerichten Berufung eingelegt werden. In solchen Fällen gibt es keine Revision zum BGH.
Ein Antrag auf einstweilige Verfügung vor einem Verletzungsgericht erfordert die „Dringlichkeit“ der Angelegenheit. Der/Die Antragsteller/-in muss deshalb vorläufigen Rechtsschutz beantragen kurz nachdem er/sie über die mutmaßlich verletzende Handlung Kenntnis erlangt hat, höchstens ein oder zwei Monate ab dem Zeitpunkt, zu dem der/die Rechteinhaber/-in erstmals Kenntnis über alle relevanten Umstände erlangt hat.
Ein vorläufiger Rechtsschutz kann vom Gericht ex parte ohne vorherige Verhandlung, zu der auch der mutmaßliche Verletzer geladen würde, erteilt werden. Ex parte Verfügungen sind trotz der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur „prozessualen Waffengleichheit“ immer noch denkbar, wenngleich höhere Anforderungen für den/die Antragsteller/-in gelten. Antragsteller/-innen sollten darauf achten, dass ihr Vorbringen im Verfügungsantrag auch vollständig im vorangegangenen Abmahnschreiben enthalten ist. Sobald die Anordnung des Gerichts ex parte erlassen wurde, muss der/die Antragsteller/-in die Verfügung innerhalb eines weiteren Monats zustellen, um die Rechte, die aus der Verfügung erwachsen, nicht zu verlieren.
Da die einstweilige Verfügung nicht dauerhaft ist, muss der/die Antragsteller/-in außerdem eine Hauptsacheklage einreichen, falls der in Anspruch genommene die einstweilige Verfügung nicht als endgültig akzeptiert.
Der mögliche Verletzer, der sich des bevorstehenden Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz möglicherweise bewusst ist, z. B. weil er eine Abmahnung erhalten hat, kann die Möglichkeit der Einreichung einer sog. Schutzschrift bei den deutschen Gerichten in Erwägung ziehen.
Sobald eine einstweilige Verfügung durch das Gericht erlassen wurde, muss sich der mutmaßliche Verletzer an die Verfügung halten; er hat jedoch die Möglichkeit, einen Widerspruch bei dem Gericht einzulegen, das die einstweilige Verfügung erlassen hat, um eine Überprüfung und möglicherweise einen Widerruf der einstweiligen Verfügung zu erwirken. Gegen jede Entscheidung, die überprüft wird, sowie gegen jedes andere vorläufige Urteil, das nach einer mündlichen Verhandlung erlassen wird, kann Berufung beim Oberlandesgericht eingelegt werden.
9.3 Einstweilige Verfügungen und Hauptsacheklagen
Das Konzept der Durchsetzung von Schutzrechten in Deutschland im Wege einstweiliger Verfügungsverfahren ist aus naheliegenden Gründen für den/die Rechteinhaber/-in sehr attraktiv, wie die zahlreichen Entscheidungen zeigen, die von deutschen erstinstanzlichen Gerichten und Berufungsgerichten erlassen wurden. Inwiefern lässt sich dann eine einstweilige Verfügung mit einer Hauptsacheklage vergleichen?
Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Verfahrenskonzepten besteht darin, dass das Hauptsacheverfahren die Angelegenheit endgültig abschließt (einschließlich der Auskunft über Gewinne und Schäden), wohingegen die einstweilige Verfügung auf ein vorläufiges und ausgewähltes Ergebnis gerichtet ist, was zur Folge hat, dass Verletzungen umgehend unterbunden werden.
Allgemein gesprochen sind für eine einstweilige Verfügung keine umfangreichen Beweise (wie die Anhörung von Zeuginnen und Zeugen) notwendig, wohingegen komplexe Fälle im Wege einer Hauptsacheklage vor Gericht gebracht werden sollten.