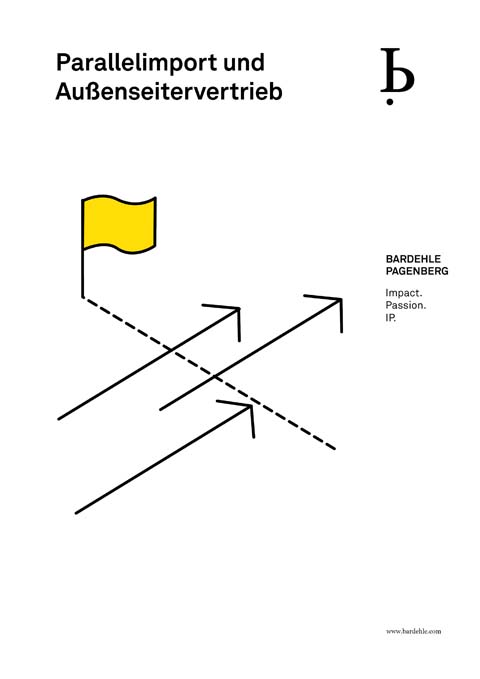Parallelimport und Außenseitervertrieb
1. Unzulässigkeit des Parallelimports
Die Unzulässigkeit des Vertriebs eines Originalprodukts kann sich im Wesentlichen aus vier Umständen ergeben:
- aus dem Umstand, dass die Ware nicht zum Vertrieb auf dem europäischen Markt bestimmt war
- aus Veränderungen, die der Händler an der Ware oder an ihrer Originalverpackung vorgenommen hat
- insbesondere bei Prestigemarkenware aus dem Vertrieb über Absatzkanäle außerhalb des vom Hersteller eingerichteten Vertriebssystems (so genannter „Außenseiter-” oder „Graumarktvertrieb“)
- bei patent- oder mit einem so genannten „ergänzenden Schutzzertifikat“ geschützten Arzneimitteln aus dem Umstand, dass das Erzeugnis aus den Beitrittsländern der Osterweiterung der Europäischen Union importiert wurde.
1.1 Unzulässigkeit wegen Inverkehrbringens außerhalb des Europäischen Wirtschaftswachstums
Das deutsche und europäische Recht des geistigen Eigentums kennt – im Unterschied zu zahlreichen anderen Ländern, die nicht der EU bzw. dem EWR angehören, insbesondere den USA und auch der Schweiz – keine weltweite Erschöpfung, sondern lediglich eine unionsweite. Wird ein im EWRrechtlich geschütztes Erzeugnis vom Hersteller außerhalb des EWR auf den Markt gebracht, darf dieses ohne die Zustimmung des Herstellers nicht im EWR vertrieben werden. Der Hersteller kann aufgrund seines Schutzrechts den Vertrieb seines Erzeugnisses verbieten, wenn er dieses außerhalb des EWR auf den Markt gebracht hat und es nicht für Länder des EWR bestimmt war. In Ländern außerhalb des EWR, die vom Grundsatz der weltweiten Erschöpfung ausgehen, wie z.B. die USA oder die Schweiz, ist dies nicht möglich. Der Hersteller kann dort den Vertrieb seines Erzeugnisses im Inland nicht allein deshalb verbieten, weil es für andere Länder bestimmt war.
Wegen der territorialen Beschränkung des Erschöpfungsgrundsatzes kann der Inhaber einer deutschen Marke oder einer Gemeinschaftsmarke mit dieser Parallelimporte aus Drittstaaten immer abwehren.
1.2 Veränderung des Erzeugnisses oder seiner Verpackung
Darüber hinaus kann ein Markeninhaber auch Parallelimporte aus EU-Staaten markenrechtlich untersagen, wenn sogenannte „berechtigte Gründe“ gegeben sind, was nach § 24 Abs. 2 MarkenG/Art. 13 Abs. 2 GMV ausdrücklich der Fall ist, wenn die Originalverpackung seiner Ware verändert wurde und ihm dies nicht vorher angezeigt wurde.
Auch wenn ihm die Veränderung der Verpackung vorher zur Kenntnis gebracht wurde, kann er in der Regel den weiteren Vertrieb seiner Ware durch Dritte in der Bundesrepublik Deutschland untersagen, wenn von seiner Ware oder ihrer Verpackung Kontrollnummern entfernt wurden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Kontrollnummern über Ort und Zeitpunkt der Herstellung Auskunft geben oder es für den Verbraucher erkennbar ist, dass eine Kontrollnummer entfernt wurde. Umverpackungen und jede sonstige Veränderung der Verpackung muss der Hersteller nur dann dulden, wenn dies seine berechtigten Interessen nicht beeinträchtigt. Voraussetzung hierfür ist unter anderem die durch den Wiederverkäufer angebrachte Angabe auf der Verpackung, dass nicht die konkrete Gefahr einer Veränderung des Originalzustands der Ware begründet wird und, dass er die Umverpackung vorgenommen hat. Weiter muss er darauf achten, dass die veränderte Verpackung nicht schadhaft oder fehlerhaft ist (z.B. die Übersetzung eines Beipackzettels) und keinen unordentlichen Eindruck hervorruft.
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann der Markeninhaber den Vertrieb untersagen. Hierzu existiert eine sehr differenzierte und gefestigte Rechtsprechung in Deutschland, die in der Regel eine verlässliche rechtliche Einschätzung erlaubt. Der EuGH hat hierzu kürzlich in einer viel beachteten Entscheidung darüber hinaus klargestellt, dass sogar die Entfernung einer Marke und Anbringung einer eigenen Marke an deren Stelle beim Import als eine die Marke verletzende Benutzung angesehen werden kann (s. EuGH Urteil vom 25. Juli 2018, C-129/17 – Mitsubishi Shoji Kaisha ./. Duma Forklifts).
1.3 Vertrieb von Original-Markenware außerhalb des selektiven Vertriebssystems („Außenseiter- oder Graumarktvertrieb“)
Zur Sicherstellung der Qualität des Vertriebs erlaubt das deutsche und europäische Recht unter bestimmen wettbewerbs- und kartellrechtlichen Voraussetzungen Vorgaben für die Vertriebspartner des Herstellers. Wird ein Erzeugnis, das über ein zulässiges selektives Vertriebssystem veräußert wird, unter Verstoß gegen Bestimmungen des selektiven Vertriebssystems an dritte, nicht autorisierte Händler veräußert, erlaubt das Markenrecht unter bestimmten Voraussetzungen dem Hersteller direkt den Durchgriff gegen diesen Außenseiter und die Untersagung des Vertriebs durch ihn.
So kann der Hersteller zum einen dann direkt gegen den Außenseiter vorgehen, wenn dieser Kontrollnummern entfernt oder unkenntlich gemacht hat, und zwar auch dann, wenn diese lediglich Angaben über den Vertriebsweg enthalten oder wenn die Entfernung oder Unkenntlichmachung für den Verbraucher nicht erkennbar ist. Die Einhaltung eines zulässigen Vertriebssystems kann daher über ein Kontrollnummernsystem, das über den Vertriebsweg der Ware innerhalb des selektiven Vertriebssystems Aufschluss gibt, wirksam gesichert werden.
Zum anderen kann der Hersteller dem Außenseiter, der Ware von einem autorisierten Händler des Vertriebssystems bezogen hat, den weiteren Vertrieb nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 23.4.2009 – C-59/08 – Copad/Dior) auch dann aufgrund seiner Marke untersagen, wenn durch den Vertrieb dieses Dritten, z.B. eines Discounters, der Prestigewert eines Markenprodukts beeinträchtigt wird. Auch in diesem Fall tritt die Erschöpfung der Markenrechte des Herstellers nicht ein, so dass er direkt gegenüber diesem Dritten ein Vertriebsverbot erwirken kann.
1.4 Einfuhr von Arzneimitteln aus den Beitrittsländern der EU-Erweiterung
Für die Untersagung des Parallelimports von Arzneimitteln besteht in der Europäischen Union ein besonderer Mechanismus. Nach diesem Mechanismus kann bei Arzneimitteln sogar der Parallelimport innerhalb der Europäischen Union untersagt werden. Der Inhaber eines Patents oder Ergänzenden Schutzzertifikats kann hiernach den Vertrieb des Arzneimittels in Ländern der Europäischen Union auch dann untersagen, wenn es mit seiner Zustimmung innerhalb der Europäischen Union, nämlich in den neuen Mitgliedstaaten, in Verkehr gebracht wurde. Bei diesen Ländern handelt es sich um die in den Jahren 2004, 2007 und 2013 der EU beigetretenen Staaten. Hintergrund dieser Regelung ist, dass in diesen Staaten im Allgemeinen kein dem westeuropäischen Standard entsprechender Patentschutz existierte. Paralleleinfuhren aus diesen Mitgliedstaaten in andere EU-Staaten, wo das Arzneimittel durch Patent oder ergänzende Schutzzertifikate geschützt sind, können mit dieser Regelung verhindert werden.
Wurde der Patentschutz oder ein Ergänzendes Schutzzertifikat für das Arzneimittel in einem Mitgliedstaat zu einer Zeit beantragt, als in einem der genannten neuen Mitgliedstaaten kein entsprechender Schutz erlangt werden konnte, kann der Inhaber die Einfuhr des Arzneimittels aus diesem Staat in ein anderes Mitgliedsland der Europäischen Union untersagen, solange dort seine Schutzrechte noch in Kraft sind. Die sonst beim Inverkehrbringen in der Europäischen Union in der Regel eintretende Erschöpfung von Immaterialgüterrechten tritt nach diesem besonderen Mechanismus ausnahmsweise nicht ein, wenn das Arzneimittel in den genannten Staaten in Verkehr gebracht worden war.
Diese Sonderregelung gilt nicht für die Beitrittsstaaten Malta und Zypern. Wurde ein Arzneimittel in diesen Staaten mit Zustimmung des Herstellers in Verkehr gebracht, sind dessen Schutzrechte grundsätzlich erschöpft, und er kann sich der Einfuhr in andere EU-Mitgliedstaaten nur nach den allgemeinen Grundsätzen (siehe insbesondere oben 1.2) widersetzen.
1.5 Folgen des BREXIT
Durch den BREXIT ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU und auch nicht des EWR. Zum Ende der Übergangsfrist am 31.12.2020 gilt Großbritannien daher als Drittland und es gelten insoweit keine Sonderregelungen zwischen der EU bzw. dem EWR und Großbritannien. Das heißt: Ware, die mit Zustimmung des Markeninhabers in Großbritannien in Verkehr gebracht wurde, kann nicht auch im EWR frei in Verkehr gebracht werden. Anders ausgedrückt: Der Inhaber einer deutschen Marken oder einer Unionsmarke kann die Einfuhr von Ware aus Großbritannien verhindern - und umgekehrt.
2. Ansprüche und prozessuale Möglichkeiten des Herstellers
Der Hersteller hat in den oben genannten Fällen der Verletzung seiner Rechte gegenüber dem Parallelimporteur oder Außenseiter alle Ansprüche, die ihm auch sonst bei der Verletzung seiner gewerblichen Schutzrechte zustehen, insbesondere Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft über den Vertriebsweg und den Umfang der rechtswidrigen Vertriebshandlungen, Vernichtung sowie Schadenersatz.
2.1 Unterlassungsanspruch und Grenzbeschlagnahme
Den Unterlassungsanspruch kann der Hersteller im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes durchsetzen, was den Erlass eines Verbotes innerhalb weniger Tage ermöglicht. Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Verfügung ist allerdings ein rasches Handeln auf Seiten des Herstellers; zwischen Kenntnisnahme des rechtswidrigen Vertriebs eines Erzeugnisses durch den Parallelimporteur oder Außenseiter und Stellung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung darf in der Regel nicht mehr als ein Monat liegen.
Der Hersteller kann in der Bundesrepublik Deutschland die Zollbehörden zur Überwachung unzulässiger Parallelimporte einschalten. Er kann beantragen, dass diese verdächtige Erzeugnisse vorläufig beschlagnahmen und eine von ihm benannte Stelle hierüber unterrichten. Er kann dann den weiteren Vertrieb durch Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe verhindern. Voraussetzung hierfür ist zunächst, dass den Zollstellen so genau wie möglich die Erkennungsmerkmale verdächtiger Ware mitgeteilt werden und nach Mitteilung über die Beschlagnahme sehr rasch – innerhalb von zwei Wochen – ein gerichtliches Vertriebsverbot beantragt wird.
Die Möglichkeit der Grenzbeschlagnahme von rechtswidrig vertriebener Originalware ist auf europäischer Ebene nicht möglich. Die Grenzbeschlagnahme auf Unionsebene erlaubt keine Beschlagnahme von Originalware. Durch die deutschen Zollstellen ist aber eine Grenzbeschlagnahme von Parallelimportware möglich.
2.2 Schadenersatzanspruch
Mit dem Schadenersatzanspruch kann der Schutzrechtsinhaber auch in Fällen der Markenverletzung häufig den Gewinn herausverlangen, den der Parallelimporteur mit dem Parallelvertrieb erzielt hat und über den er Rechnung legen muss.
Dies gilt nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für den Parallelvertrieb von Arzneimitteln, die aus arzneimittelrechtlichen Gründen nicht unter einer anderen Marke vertrieben werden können. Nach dieser Rechtsprechung ist aber davon auszugehen, dass der Rechteinhaber auch beim rechtswidrigen Parallelvertrieb anderer medizinischer Erzeugnisse den gesamten Gewinn des Parallelimporteurs herausverlangen kann, sofern davon auszugehen ist, dass das Erzeugnis am Markt nicht akzeptiert werden würde, wenn es unter einer anderen Marke vertrieben worden wäre.